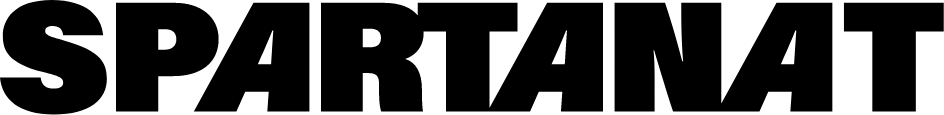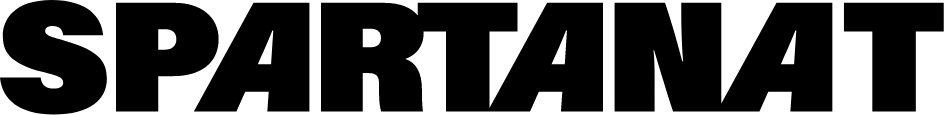Hol Dir den wöchentlichen SPARTANAT-Newsletter.
Dein Bonus: das gratis E-Book von SPARTANAT.

BLACKOUT (1): Es wird sehr schwierig sein, die Kontrolle zu bewahren
Evi Pohl-Iser wird ihr ganz persönliches Blackout-Erlebnis vom 31. Juli 2018 nicht so schnell vergessen.
Evi Pohl-Iser wird ihr ganz persönliches Blackout-Erlebnis vom 31. Juli 2018 nicht so schnell vergessen. „Mit dem Strom fiel auch das Mobilfunknetz sofort aus“, erinnert sie sich gegenüber ADDENDUM. Was wie das Luxusproblem einer vollvernetzten Großstadtbewohnerin klingt, war tatsächlich richtig gefährlich. Pohl-Iser leitet beim Wiener Hilfswerk den Bereich „Hilfe und Pflege daheim“, vom Bezirk Neubau aus, wo alle Daten für ihr mobiles Team in Echtzeit zusammenlaufen. Ingesamt koordiniert sie 2.000 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter.
An jenem Dienstagnachmittag im Hochsommer schwitzten bei über 30 Grad Außentemperatur nicht nur die Menschen in den Cafés von Wiens schickem Innenstadtbezirk. Pohl-Iser und ihrem Team wurde aus anderen Gründen heiß. Weite Teile Neubaus waren aufgrund eines Kabeldefekts für mehrere Stunden ohne Strom. Und damit ohne mobiles Datennetz. Dieses ist jedoch wichtig für die Kommunikation und den Datenaustausch mit den Pflegern draußen bei den Menschen. Kranken Menschen. Hilfsbedürftigen Menschen.
„Zu vielen von ihnen war der Zugang nicht mehr möglich, weil ohne Strom auch die Türöffner der Schließanlagen für Hauseingangstüren nicht mehr funktionierten“, beschreibt sie heute die damalige Situation. Für einen Gesundheitsdienstleister wie das Hilfswerk war das ein Albtraum. „Auch die Lifte waren außer Betrieb.“ Und das vielleicht Schlimmste: „Die Pflegeanleitungen mit Medikamentendosierungen, die via Mobilfunk von der Zentrale auf die mobilen Tablets der Mitarbeiter gespielt werden, waren nicht mehr abrufbar.“ Zum Beispiel? „Lebens- und überlebensnotwendige Tätigkeiten wie das Messen und Verabreichen von Insulin. Flüssigkeits- und Essensgabe. Inkontinenzversorgung. Medikamentenverabreichung.“
Was das Wiener Hilfswerk und wenige tausend Anwohner im Sommer in Wien-Neubau erlebten, war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn der Strom in größeren Flächen für längere Zeit wirklich ausfällt. In einem Bundesland, in einem Staat, europaweit. Kurz: bei einem sogenannten Blackout.
Glaubt man der Meinung von Experten, ist ein Blackout einer der am wahrscheinlichsten eintretenden Katastrophenfälle, das lässt sich in mehreren Untersuchungen nachlesen. Zum Beispiel aus Österreich. Oder aus der Schweiz. Warum Sie sich als Bürger im Krisenfall vom Staat nicht allzu viel Hilfe erwarten können, und wo es dann vielleicht doch funktioniert, lesen Sie in den folgenden drei Kapiteln.
 I. Tiefe Kluft zwischen Theorie und Praxis
I. Tiefe Kluft zwischen Theorie und Praxis
Auf unserer Recherchereise durch die Institutionen erlebten wir Erstaunliches. Entscheider und Amtsträger, die vor der Kamera auftraten, betonten stets die vorbildliche Vorbereitung und das Vorliegen von Krisenplänen für ein Blackout-Szenario. Läuft die Kamera jedoch nicht mehr, dann fallen viele Antworten anders aus.
Der tiefste Graben tat sich – inhaltlich, nicht räumlich – zwischen dem Regierungsviertel in der Wiener City und dem barocken Schloss Laudon in Hadersdorf am Stadtrand auf.
Im Innenministerium in der City besuchten wir Johann Bezdeka, den verantwortlichen Beamten für Zivil- und Katastrophenschutzmanagement, in seinem Büro. Im alten Wasserschloss hingegen trafen wir im Rahmen einer Tagung mit hundert Experten aus Ministerien, Behörden und Einsatzorganisationen zusammen. Während uns Bezdeka, der ranghohe Polizist, vor der Kamera erklärte, dass Österreich in Bezug auf Blackout-Vorbereitungen „sehr, sehr gut aufgestellt“ sei, hörte sich das in Schloss Laudon ganz anders an.
Zwischen „Sisi-“ und „Petersburg-Zimmer“ konnten Anfang September Vertreter von Polizei, Militär, Gesundheitseinrichtungen, Regierungsbehörden, Bundesländern und mehr ganz offen sprechen. Es galt die Chatham-House-Rule. Das sollte schonungslose Diskussion ohne Rücksichtnahme auf öffentlichkeitswirksame oder gar politische Befindlichkeiten ermöglichen. In den Pausen gab es Gulasch und Würstel vom Roten Kreuz. Und tatsächlich: Die Anwesenden sprachen offen. Sehr offen.
Einer der teilnehmenden Vertreter des Bundesheers fasste Österreichs Problem auf dem Podium in einem Satz zusammen: „Planerisch sind wir gut unterwegs, praktisch fehlen uns die Mittel.“ Damit sprach er ein zentrales Problem an.
Katastrophenschutz betrifft in Österreich viele Teilnehmer: Gemäß Verfassung ist er Aufgabe der Länder, die eine Art Befehlskette nach unten über Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden auslösen. Der Bund, also das Innenministerium, nimmt nur eine koordinierende Rolle wahr.
Im Fall eines Blackouts, der per Definition überregional auftritt, versucht der Staat mithilfe einer in Serie geschalteten Kaskade unterschiedlicher Katastrophenpläne der Sache Herr zu werden. Länder, Bezirke, Gemeinden und alle möglichen Einsatzorganisationen haben ihre eigenen Pläne. Das ist theoretisch gut, praktisch haben jedoch alle eine zentrale Schwäche: Sie funktionieren nur, solange auch die Kommunikation zwischen allen Beteiligten funktioniert. Und diese – wir erinnern uns an die Schilderungen von Evi Pohl-Iser vom Wiener Hilfswerk – fällt nicht selten als Erstes aus.
Behördenfunk mit Schwächen
Theoretisch und auf dem Papier ist die Notfallversorgung Österreichs bei einem Blackout also präzise geregelt. Praktisch, das bemängelten bei der Expertentagung im Schloss Laudon Vertreter aus behördlichen und zivilgesellschaftlichen Bereichen, sei man aber darauf nicht vorbereitet. Sogenannte Offline-Szenarien, in denen auch die Kommunikation betroffen ist, werden in den Krisenplänen kaum bedacht und auch nicht geübt.
Oder es fehlen – wie während der Recherche mehrere hochrangige Vertreter des Bundesheers bestätigten – die Mittel dafür. Die Schlüssel-Infrastruktur dabei ist jedoch nicht nur das bei Stromausfällen besonders anfällige Mobilfunknetz. Auch der digitale Behördenfunk, an dem neben der Polizei sämtliche Einsatzorganisationen hängen, hat seine Schwächen. Es ist nämlich so:
Die zentrale Vermittlungsstelle, die sich im Süden Wiens befindet, hat nach unseren Recherchen einen Batteriepack für Notsituationen, der laut Plan gerade einmal 24 Stunden durchhält. Getestet wurde das – angeblich – noch nie. Diese Information ist jedoch offiziell unbestätigt, ebenso wie jene über die Durchhaltefähigkeit der unzähligen Sendestationen im gesamten Bundesgebiet.
Diese sollen nach unterschiedlichen Angaben von Behördenvertretern zwischen 24 und 72 Stunden batterieversorgt funktionieren. Anschließend sei für den Weiterbetrieb der Besuch der Feuerwehr mit einem Notstromaggregat notwendig. Ein Aufwand, der bundesweit nicht zu schaffen ist.
Wenn alle Stricke reißen, können Behördenfunk-Endgeräte anders als Smartphones auch direkt und ohne Basisstation innerhalb der eigenen Reichweite miteinander kommunizieren. Die Akkus halten jedoch nur wenige Stunden, und die wenigsten Polizeiinspektionen verfügen – etwa zum Aufladen – über eine eigene Notstromversorgung.
Eine Alternative, das sogenannte Staatsgrundnetz, das völlig – und damit auch von der öffentlichen Stromversorgung – autark funktionierte, ist seit 2001 nicht mehr betriebsfähig. Wolfgang Lehner und Sandra Haas vom kommerziellen Krisenberater EMERISIS sehen die Vorbereitungen Österreichs für den Blackout-Fall kritisch. Sie sagen: „Österreich ist eher schlecht aufgestellt.“
II. Militär und Polizei: Bedingt dienstbereit
„Das Blackout-Szenario ist ein unterschätztes. Es wird sehr schwierig sein, die Kontrolle zu bewahren.“ Peter Goldgruber, Generalsekretär des Innenministeriums, bewertet die Krisenfestigkeit der Polizei als schlecht. Der 57-Jährige ist damit einer von ganz wenigen Behördenvertretern, die offiziell auch Probleme benennen. Welche, das erklärte er uns vor der Kamera:
Offenbar hat sich an der schwachen Krisenfestigkeit der Exekutive, die im Fall eines Blackout während der Chaos-Tage eminent wichtig für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung wäre, wenig geändert. Bereits vor vier Jahren sprach einer unserer Reporter – er war damals für Die Presse tätig – mit dem Leiter der Abteilung für Sicherheitspolitik im Innenministerium, Kurt Hager. Der sagte: „Die Polizei ist während der vergangenen 25 Jahre eine Schönwetterorganisation geworden.“
Tatsächlich verfügt die Polizei über keine nennenswerten Nahrungsvorräte für Krisenlagen, Notstromaggregate oder gar Treibstoffvorräte. Fallen mit dem Strom die Tankstellen aus, müssen sich die Einsatzwagen, so sie denn mit Diesel betrieben werden, vergleichsweise umständlich ihren Treibstoff an den Autobahnmeistereien der Asfinag holen. Diese sind nämlich autark. Der entsprechende Vertrag sieht jedoch vor, dass zuerst der Eigenbedarf der Asfinag zu decken ist. Die Polizei muss im Krisenfall also warten. Bleibt als letzte staatliche Institution das Militär.
Bundesheer: Helfen, wo andere nicht mehr können?
Tatsächlich warb das Bundesheer einst mit dem nicht uncharmanten Slogan „Helfen, wo andere nicht mehr können“ für sich selbst. Aber kann das Militär auch bei Blackout-Katastrophen jene „strategische Handlungsreserve“ sein, die es laut Verteidigungsstrategie der Republik (Wehrgesetz, § 2 d) Katastrophenhilfe) sein soll? Und die es in Form von Assistenzleistungen bei unzähligen anderen Einsätzen in der Vergangenheit stets war? Der Eindruck, den wir im Rahmen unserer Recherchen erlangten, lautet: eher nein.
Für diesen Befund gibt es mehrere Gründe:
- Unzureichende Treibstoffversorgung: Ohne Treibstoff steht das Land. Ohne Strom funktionieren jedoch auch die Tankstellen nicht mehr. Nur sehr wenige öffentliche Tankstellen verfügen über eine eigene Notstromversorgung. Das Gleiche gilt derzeit und unseren Quellen zufolge für die meisten militärischen Zapfanlagen in den Kasernen. Mit den wenigen vorhandenen Handpumpen könnte das Bundesheer weder sich selbst noch den Kooperationspartner Polizei ernsthaft über einen mehrere Tage andauernden Blackout mit Treibstoff versorgen.
- Fehlende Wasserversorgung: Wasser ist in vielerlei Hinsicht essenziell. Einerseits zum Trinken. Andererseits für den Betrieb sanitärer Anlagen und der Kanalisation, Stichwort: Seuchenschutz. Studien zufolge verfügen nur elf bis 26 Prozent der Österreicher über Wasservorräte für Krisenlagen. Das Bundesheer über – annähernd – keine. Zwar betrieben einige Kasernen einst eigene Brunnen, diese Anlagen wurden jedoch aufgegeben.
- Keine Nahrungsreserven: Der Zivilschutzverband und die Bundesregierung empfehlen der Bevölkerung in unterschiedlichen Broschüren, dass diese für Krisen einen Lebensmittelvorrat für einen Zeitraum von zwei Wochen anlegen. Diese Vorgabe kann das Bundesheer selbst nicht erfüllen. Einst verfügte das Militär über Vorräte von Haltbarnahrung, die durch den ständigen Verbrauch bei Übungen – Teilnehmer werden sich noch an die Kaltverpflegung, KV, erinnern – erneuert wurden. Heute ist das genauso Geschichte wie selbstständige Versorgung der Soldaten durch die jeweilige Kasernenküche. Die knapp 60 Standorte des Bundesheers werden inzwischen von nur vier zentralen Großküchen aus beliefert. In Krisensituationen ist das jedenfalls kein Vorteil.
Das Bundesheer kennt seine Schwächen in Bezug auf das autarke Funktionieren. Deshalb brachten die Generäle in den Verhandlungen für das aktuelle Regierungsprogramm auch zwei entscheidende Forderungen durch: 1.) Stärkung der allgemeinen Autarkie von Kasernen. 2.) Ausbau bestimmter Kasernen zu sogenannten „Sicherheitsinseln“, die in Krisensituationen wie einem Blackout die regionale Durchhaltefähigkeit deutlich erhöhen. Darunter fallen insgesamt zwölf Standorte in Österreich (siehe folgende Grafik).
 So lautet jedenfalls der Plan. Draußen, im Feld, so bezeichnen Soldaten gerne die weniger gut planbare Realität, sieht es offenbar nicht so schön aus. Das würde erklären, warum Fragen zu Ausgestaltung, Leistungsfähigkeit und Nutzen von Sicherheitsinseln für Bevölkerung und Militär im Blackout-Fall nicht beantwortet werden.
So lautet jedenfalls der Plan. Draußen, im Feld, so bezeichnen Soldaten gerne die weniger gut planbare Realität, sieht es offenbar nicht so schön aus. Das würde erklären, warum Fragen zu Ausgestaltung, Leistungsfähigkeit und Nutzen von Sicherheitsinseln für Bevölkerung und Militär im Blackout-Fall nicht beantwortet werden.
Das betraf die parlamentarischen Anfragen des SPÖ-Abgeordneten Rudolf Plessl sowie NEOS-Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff genauso wie unsere: In allen drei Fällen argumentierte Verteidigungsminister Mario Kunasek, dass eine öffentliche Beantwortung Rückschlüsse auf die Einsatzbereitschaft des Bundesheers zuließe, und Informationen dazu deshalb in die Kategorie militärisches Geheimnis fielen.
Das Gleiche erlebten wir beim obersten Vertreter der Miliz, Raiffeisen-Niederösterreich-Wien-Boss, Generalmajor und Milizbeauftragten Erwin Hameseder. Er wollte zu unseren Fragen zum Thema Blackout am Rande des jährlichen Sicherheitsgipfels des „Kuratorium Sicheres Österreich“ nicht Stellung nehmen. Auch der Generalstab des Heeres wollte unsere Fragen zur Leistungsfähigkeit der Sicherheitsinseln – zumindest schriftlich – nicht beantworten.
Dafür empfing uns Johann Luif, Generalleutnant und Leiter der Generalstabsdirektion, im Verteidigungsministerium. Der Burgenländer ist damit einer der ranghöchsten Militärs im Land. In seinem Büro in der mächtigen Rossauer Kaserne in Wien machte er im Wesentlichen die Unterdotierung des Bundesheers für dessen Schwächen verantwortlich. Und forderte – doch recht deutlich – die Bevölkerung auf, im Falle eines Blackout eher auf sich selbst zu schauen als Hilfe zu erwarten, denn: „Die Einsparungen gehen zulasten der Widerstandsfähigkeit des Militärs.“ Und weiter: „Die Garnisonen des Bundesheeres können die Versorgung von 8,9 Millionen Österreichern nicht gewährleisten.“
III. Licht am Horizont
Wenn der Staat nicht mehr kann, dann schlägt die Stunde von Eigenverantwortung und Zivilgesellschaft. Gerade Österreichs Bürger haben in diesem Zusammenhang eine nicht zu unterschätzende Erfahrung. Während des Kalten Krieges erlebte der Zivilschutzgedanke seine Hochblüte. In manchen Bereichen schrieb die Regierung die Vorsorge sogar vor.
Sieben von neun Bundesländern (Ausnahmen Wien und Salzburg) verpflichteten einst auch private Bauherren, Neubauten mit Schutzräumen auszustatten, zum Schutz der Bevölkerung vor radioaktiver Strahlung. Der Schutz vor Treibstoffknappheit nach einem Blackout hat anscheinend eine viel geringere Priorität. So war die verpflichtende Vorschreibung von Notstromaggregaten für Tankstellen nur kurz Thema. Der Gedanke wurde verworfen.
Vorbild Rotes Kreuz
Dennoch gibt es Menschen und Initiativen, die sich – offenbar – besser auf den Blackout vorbereiten als der Staat. Karl-Dieter Brückner zum Beispiel, und sein Arbeitgeber, das Rote Kreuz. Seit 2001 baut die Organisation an Stützpunkten, die auch mehrere Tage ohne Strom völlig autark einsatz- und versorgungsbereit wären. Mit Notstrom, Treibstoff- und Lebensmittelvorräten. Mit Richt- und Amateurfunk statt dem viel sensibleren digitalen Behördenfunk. „Das Wichtigste“, sagt Brückner, der Landesrettungskommandant von Wien, „ist eine möglichst autarke Infrastruktur.“
Auch auf lokaler Ebene geschieht inzwischen einiges in Bezug auf Information und Bewusstseinsbildung. Erst Anfang September verschickte die steirische Gemeinde Feldbach an alle Bürger eine Informationsbroschüre zum Thema Blackout, inklusive Beschreibung von Ursachen, Folgen und Hinweisen, wie man die schlimmsten Auswirkungen als Privater lindern kann.
Zurückzuführen sind solche lokalen Initiativen auf Experten wie Herbert Saurugg. Der ehemalige Soldat hat sich bereits vor einigen Jahren als Berater zum Thema Blackout selbstständig gemacht, organisiert Konferenzen, vernetzt Interessierte und hält Vorträge – unter anderem bei Gemeinden und Bezirksverwaltungsbehörden. Panik, erzählt er, habe er damit noch nie ausgelöst. Nur Interesse. Warum? „Zwar gibt es bei der Vorbereitung auf einen Blackout nur wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren.“
Ernüchternde Erkenntnis
Das weiß auch Evi Pohl-Iser. Für die Leiterin der mobilen Hilfswerk-Pflege in Wien war der Stromausfall im Sommer 2018 ein einschneidendes Erlebnis. Sie erfuhr am eigenen Leib, wie hilflos Helfer und Hilfsbedürftige mit einem Schlag sind, wenn der Strom ausfällt. Inzwischen hat sie ihre Erlebnisse von damals aufgeschrieben und hält Vorträge darüber, wie es einem geht, wenn nichts mehr geht. Nicht um Panik zu verbreiten, sondern um aufzuklären.
Und um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich auch Pflegebedürftige und Angehörige nicht ausschließlich auf Dritte verlassen sollten: „Denken wir immer an die Kunden zuerst? Nein. Somit bleibt nur eines: im Vorfeld Kundinnen und Kunden informieren, dass wir nicht mehr kommen, wenn der Strom bei ihnen im Bezirk großflächig ausfällt.“
ADDENDUM Artikelserie zum Blackout in Österreich:
Die Einleitung auf SPARTANAT: Österreich übt den Blackout
Teil 1: Es wird sehr schwierig sein, die Kontrolle zu bewahren
Teil 2: Nichts geht mehr – die Auswirkungen eines Blackout
Teil 3: Land ohne Strom – Mögliche Ursachen für einen Blackout
Dieser Artikel wurde zuerst auf ADDENDUM veröffentlicht. Copyright Text: ADDENDUM. Bilder: ADDENDUM. Videobeiträge, Grafiken und Audiobeiträge: ADDENDUM.
ADDENDUM im Internet: www.addendum.org
SPARTANAT ist das Online-Magazin für Military News, Tactical Life, Gear & Reviews.
Schickt uns eure News: [email protected]
Werbung
Hol Dir den wöchentlichen SPARTANAT-Newsletter.
Dein Bonus: das gratis E-Book von SPARTANAT.